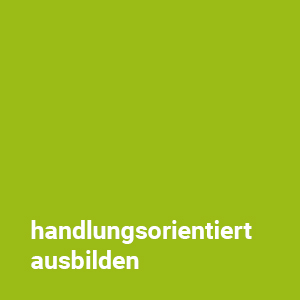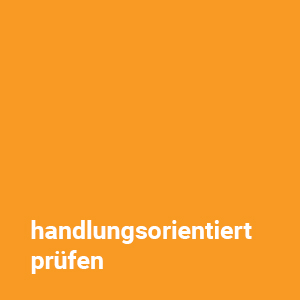berufliche Handlungsfähigkeit
Weshalb „berufliche Handlungsfähigkeit“ in der Berufsbildung?
Das Berufsbildungsgesetz beschreibt seit 2005 die Vermittlung von beruflicher Handlungsfähigkeit als grundsätzliches Ziel der Berufsbildung.
1, Abs.3 Berufsbildungsgesetz (BBIG)
„Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung zu ermöglichen.“
Das bedeutet, dass alle relevanten Akteure im Rahmen der beruflichen Ausbildung auf dieses Ziel hinarbeiten und sich deshalb mit den Grundlagen der beruflichen Handlungsfähigkeit, entsprechenden Lehr- und Lernmethoden sowie Prüfungsverfahren auseinandersetzen sollen:
- Ausbilderinnen und Ausbilder in Betrieben und überbetrieblichen Ausbildungsstätten
- Auszubildende
- Berufsschullehrerinnen und –lehrer
- Prüferinnen und Prüfer
- Ausbildungsberaterinnen und –berater der zuständigen Stellen (Kammern, Ämter, usw.)
Die Erklärung für diese Neuausrichtung der Berufsausbildung liefert der Gesetzestext gleich mit: In Ausbildung befindliche Menschen sollen für die Anforderungen der sich kontinuierlich wandelnden Arbeitswelt vorbereitet werden.
Begründet wird dieser Wandel mit immer rasanter stattfindenden gesellschaftlichen und technologischen Veränderungsprozessen. Besonders deutlich wird diese Entwicklung an der immer kürzer werdenden Halbwertszeit von Wissen. Digitalisierung, Globalisierung und zunehmende Ökologisierung sind zusätzliche Treiber dieses Wandels.
Stellen Sie sich alleine mal vor, was sich seit Ihrer Ausbildungszeit in Ihrem Beruf und an den berufs- und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen alles verändert hat. Lebenslanges Lernen ist erforderlich, um einen Beruf über viele Jahre erfolgreich auszuüben.
Um sich diesen permanenten Veränderungen im Beruf und dessen Umfeld anpassen zu können, reichen allein der Erwerb von fachlichem Wissen und Fertigkeiten nicht mehr aus. Hierfür braucht es weitere, sogenannte Schlüsselkompetenzen, die in unterschiedlichen Situationen nutzbar sind.
In der vorherigen Fassung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) war das Ziel der Berufsausbildung, den Auszubildenden die notwendigen Kenntnisse (Fachwissen) und Fertigkeiten (handwerkliche Umsetzung) zu vermitteln. Im Mittelpunkt standen also die fachspezifischen Qualifikationen.
Bereits in den 1990er Jahren rückten neue Leitbilder in den Fokus der beruflichen Bildung. Gefordert wurde mehr Praxisnähe sowie die Orientierung an realen betrieblichen Arbeitsprozessen.
Dies fand u. a. Eingang in Ausbildungsordnungen aus dieser Zeit.
Beispiel:
Verordnung über die Berufsausbildung zum Landwirt / zur Landwirtin
Ausbildungsordnung für den Beruf Landwirt/in (1995), § 3 (2):
„Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, dass der Auszubildende zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt wird, die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt.“
Welchen Nutzen bringt das Prinzip der beruflichen Handlungsfähigkeit für die Ausbildung in den grünen Berufen?
Ist und war die agrarische Berufsbildung nicht schon immer per se stark an der Praxis und an realen betrieblichen Arbeitsprozessen ausgerichtet? Der erfahrene Ausbilder wird dem sicher zustimmen. Dies bringen sowohl die Tätigkeiten als solche als auch die betrieblichen Strukturen mit sich. In anderen Ausbildungsbereichen wie etwa den kaufmännischen oder gewerblich-technischen Berufen mag dies teilweise, je nach betrieblicher Struktur, anders aussehen. Da das Berufsbildungsgesetz für alle geordneten Ausbildungsberufe gilt und ebenso die grünen Berufe permanenten Wandlungsprozessen unterworfen sind, bringt die Orientierung an der beruflichen Handlungsfähigkeit für die Ausbildung in den grünen Berufen zusätzliche Vorteile.
Auch in der grünen Branche haben sich die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen stetig verändert. Das allein nimmt schon Einfluss auf die Ausrichtung der Ausbildung und verlangt nach zusätzlichen fachübergreifenden Kompetenzen.
Betriebe wollen und brauchen selbstständig arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigenverantwortlich handeln und ihre Aufgaben fachlich kompetent und zuverlässig erledigen, die zugleich im Sinne des Unternehmens denken und handeln und bereit sowie in der Lage sind, sich entsprechend der an sie gestellten Anforderungen auch laufend fortzubilden und weiterzuentwickeln.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss ein Mitarbeiter über unterschiedliche Kompetenzen verfügen. Es reicht nicht aus, sich fachlich gut auszukennen. Man muss es auch praktisch und persönlich umsetzen können und wollen und in unterschiedlichen Situationen Entscheidungen treffen können. Dies alles umfasst die berufliche Handlungsfähigkeit. Sie ist insofern keine Neuerfindung, sondern ein Ausdruck dessen, was in der Praxis gewünscht und gefordert ist.
Ausbildern soll die Ausrichtung an der beruflichen Handlungsfähigkeit bewusst machen, wie selbstständiges berufliches Handeln in einer sich wandelnden Berufs- und Arbeitswelt gefördert werden kann.
Berufsschullehrern soll das Prinzip der Handlungsorientierung dabei helfen, einen an der Praxis ausgerichteten Unterricht zu gestalten und die Lehrinhalte praxisnah miteinander zu verzahnen.
Auszubildenden ermöglicht das Prinzip der Handlungsorientierung, übergreifende Fähigkeiten zu entwickeln für erfolgreiches berufliches Handeln – heute und in Zukunft. Im besten Fall unterstützt es sie dabei, einzelne Lerninhalte und Fertigkeiten besser in einen Gesamtzusammenhang einordnen zu können und dadurch Antworten auf die Frage nach dem „Warum“ zu finden.
Warum macht man dies so? Wozu ist es wichtig, das zu wissen? Wofür kann ich diese Fähigkeit noch einsetzen? Die Frage nach dem „Warum“ ist eine der Schlüsselfragen beim selbstorganisierten Lernen. Wer als Lernender ein „Warum“ kennt, der kann auch seine Motivation leichter zum Tragen bringen, indem er den Nutzen des Neuen für sich erkennt.
Definition der beruflichen Handlungsfähigkeit
Berufliche Handlungsfähigkeit meint die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen beruflichen Situationen sowohl fachlich kompetent, arbeitsorganisatorisch sinnvoll als auch persönlich und sozial verantwortlich verhalten zu können. Sie ermöglicht also dem Inhaber einer beruflichen Rolle, die Aufgaben und Herausforderungen seines Berufes bewältigen zu können.[1]
Die Begriffe „berufliche Handlungsfähigkeit“ und „berufliche Handlungskompetenz“ werden oft synonym verwendet.
Berufliche Handlungskompetenz setzt sich zusammen aus.
- Fachkompetenzen
- Methodenkompetenzen
- Sozialen Kompetenzen
- Selbstkompetenzen
Die Schnittmenge dieser Kompetenzen, die für die Erfüllung unterschiedlicher beruflicher Anforderungen erforderlich ist, kann als berufliche Handlungsfähigkeit bezeichnet werden.